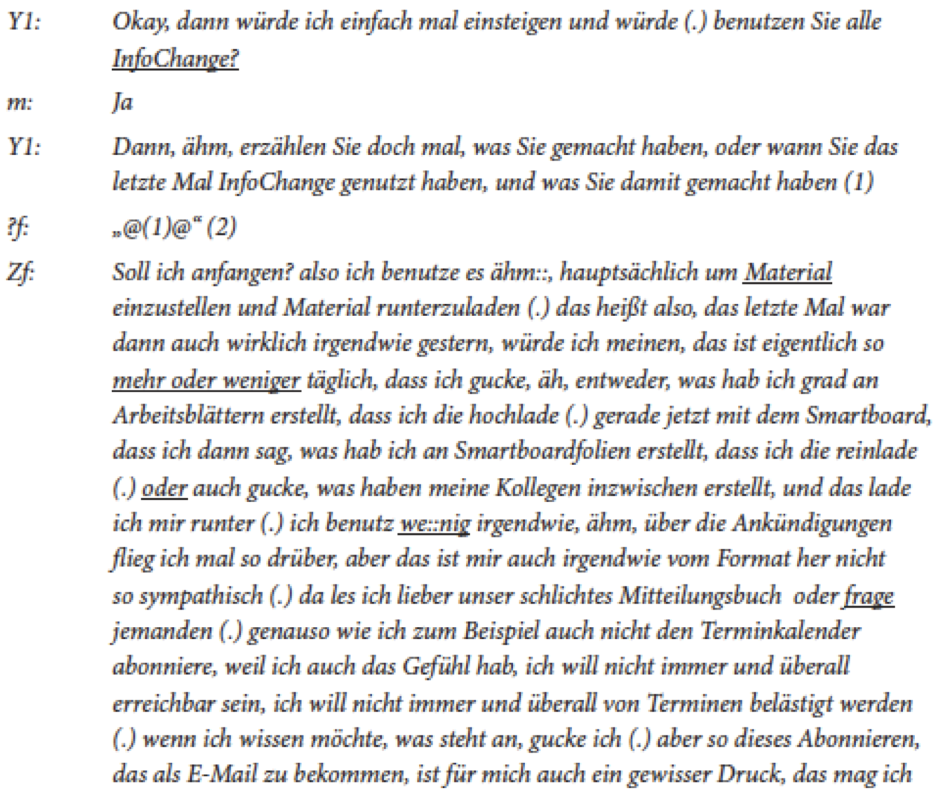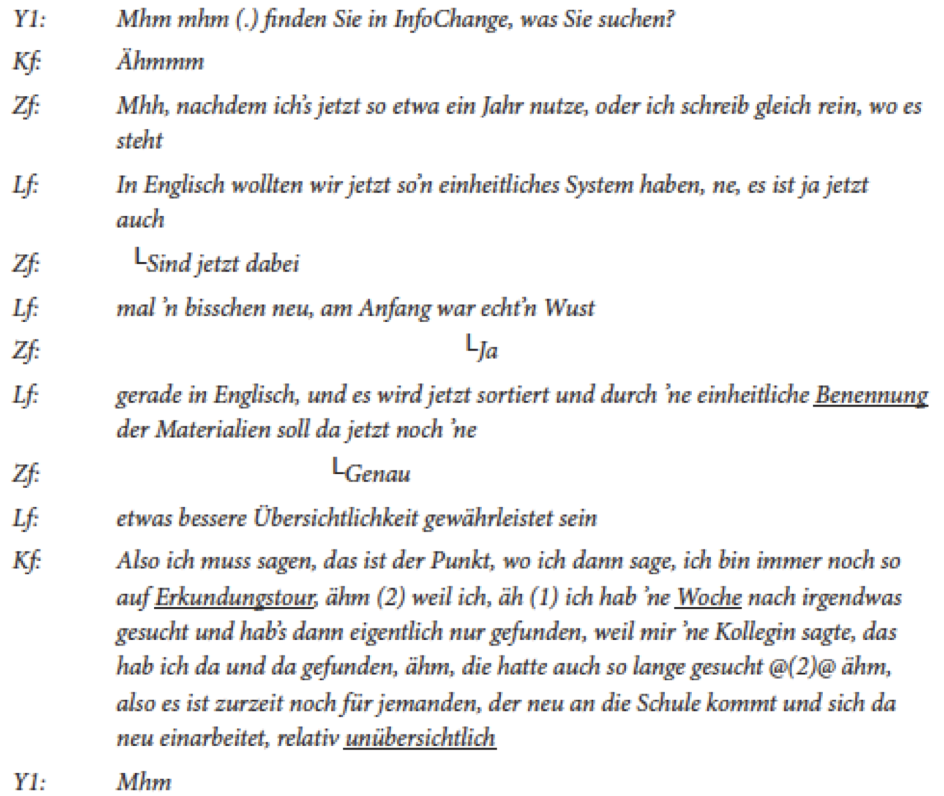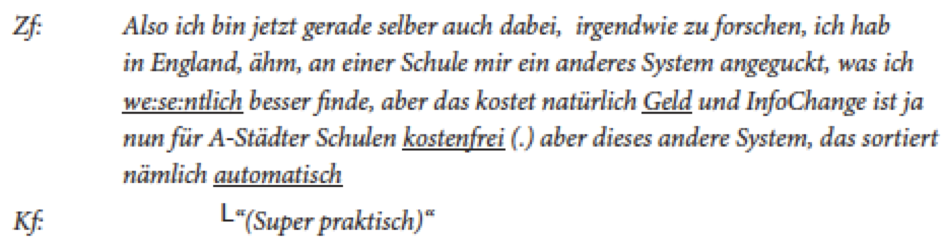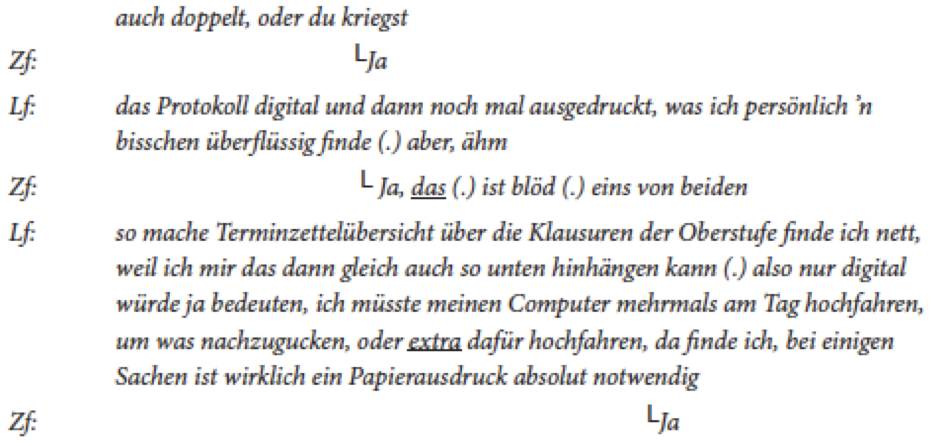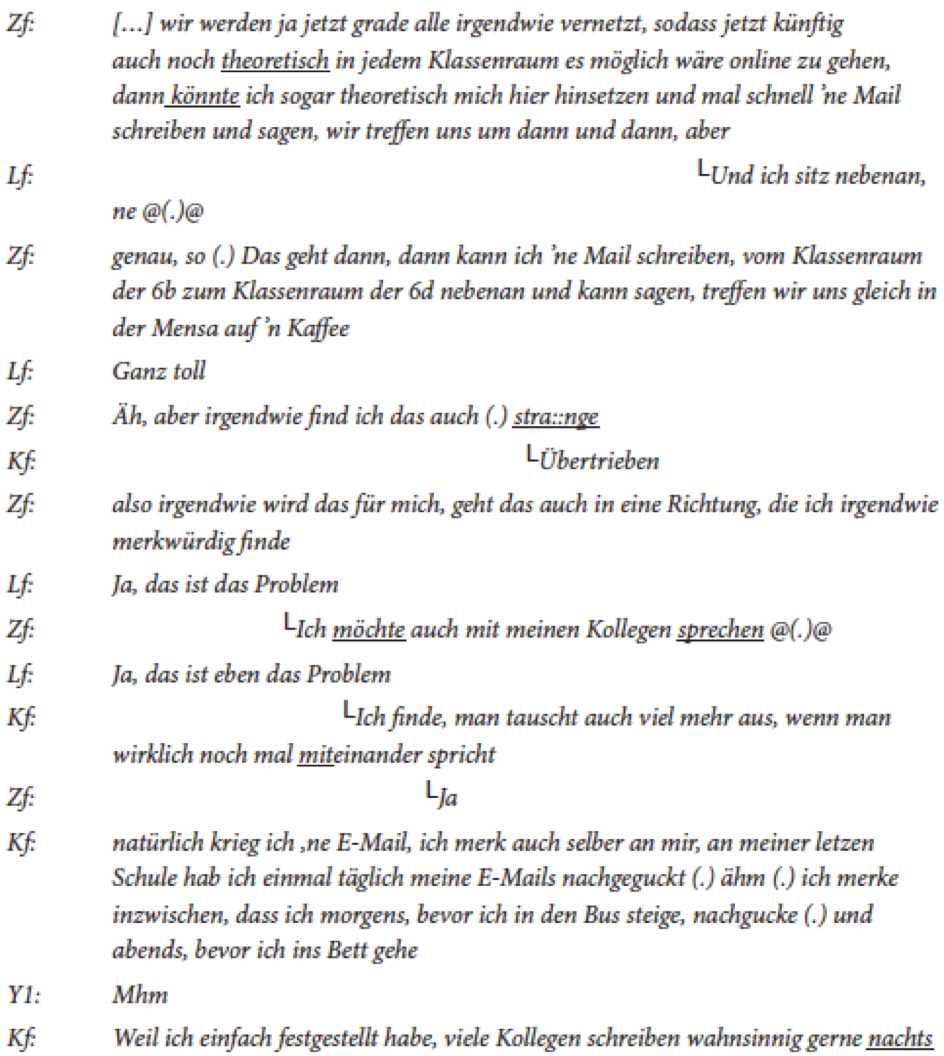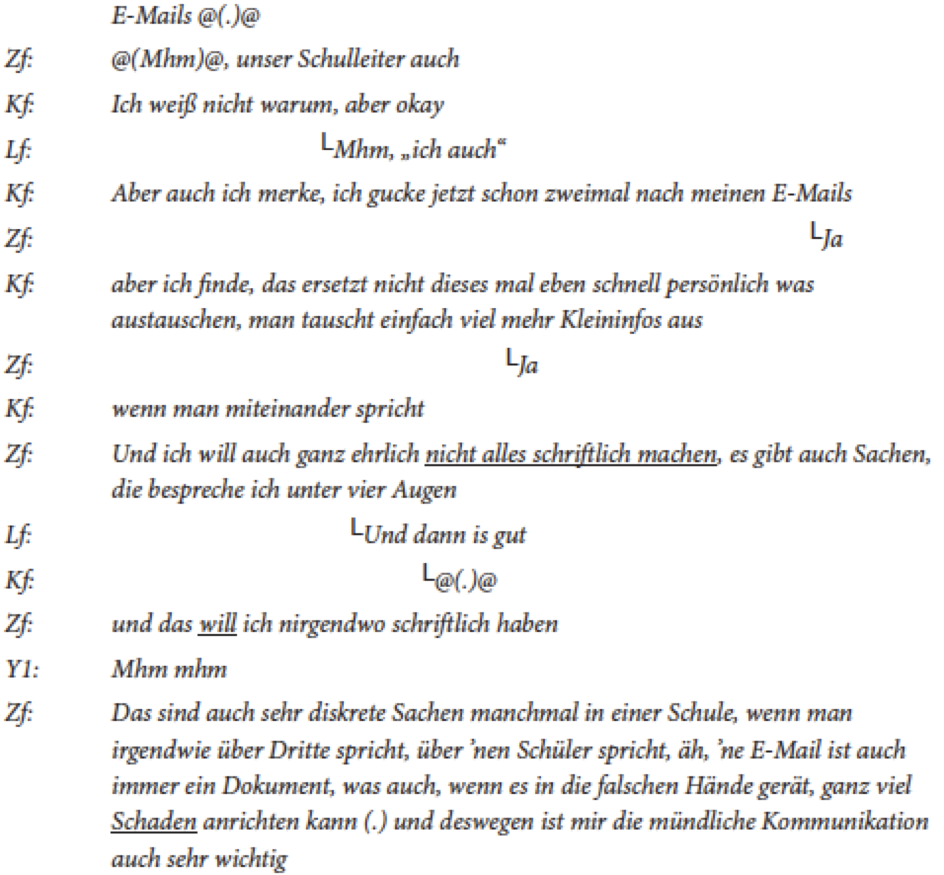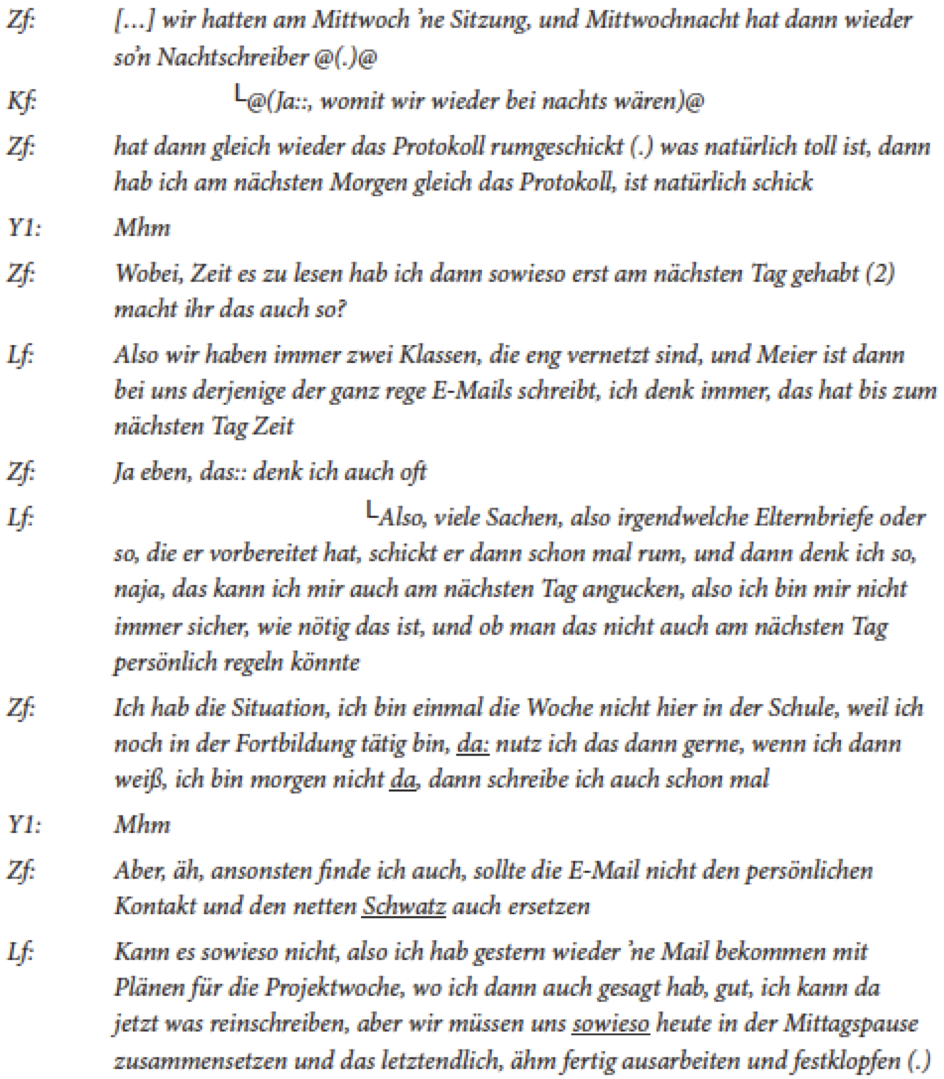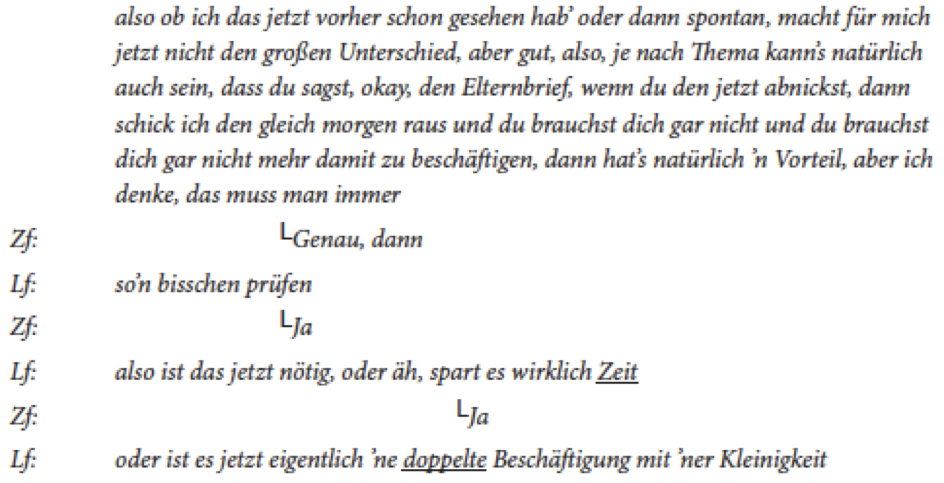Hinweis: Der Fall kann gemeinsam gelesen werden mit:
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Ahorn“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Zypresse“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Lärche“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Platane“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Fichte“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Buche“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Birke“
Einleitende Bemerkungen
Die Bergschule ist eine große Gesamtschule an der zum Zeitpunkt der Datenerhebung rund 1.100 Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse in jeweils sieben Zügen ganztägig unterrichtet werden. Die Schule befindet sich in einem großen Gebäude mitten im Stadtteil, das auch noch andere Bildungseinrichtungen beherbergt. Die Schule erstreckt sich über drei Etagen. In den ersten beiden Etagen befinden sich u. a. die Klassen- und Fachräume. An die Klassenräume grenzen große Freiflächen, auf denen sich die Schülerinnen und Schüler auch während der Pausen aufhalten. Die Klassen- und Fachräume verteilen sich über die ersten beiden Stockwerke des Gebäudes. Im dritten Stockwerk sind die Mitglieder der Schulleitung und der Schulverwaltung untergebracht. Die einzelnen Etagen sind durch mehrere Treppen und Fahrstühle miteinander verbunden. Einige Lehrkräfte weisen darauf hin, dass man aufgrund der Größe der Schule bei Raumwechseln häufig relativ weite Wege zurücklegen muss, und die dafür notwendige Zeit dann z. B. nicht mehr für die Kommunikation mit Kolleginnen oder Kollegen zur Verfügung steht.
Falldarstellung mit interpretierenden Abschnitten
Die Gruppe Esche besteht aus drei Pädagoginnen. Frau Lübbe (40 Jahre alt) und Frau Zimball (35 Jahre alt) sind seit fünf bzw. sechs Jahren im Schuldienst tätig. Während Frau Zimball immer an der Bergschule gearbeitet hat, unterrichtet Frau Lübbe dort seit zwei Jahren. Die 29-jährige Frau Kiefer ist ebenfalls seit fünf Jahren im Schuldienst tätig, davon aber erst vier Wochen an der Bergschule. Frau Lübbe ist Klassenlehrerin in der Jahrgangsstufe 6, Frau Zimball in Klasse 5.
Die Nutzung von InfoChange durch die Lehrerinnen
Auch diese Gruppendiskussion beginnt mit der Frage an die Lehrerinnen, wann sie zuletzt InfoChange benutzt haben und wofür. Die drei Frauen nutzen das System unterschiedlich (Gruppe Esche, Passage „InfoChange“).
Frau Zimball nutzt das SIS vor allem, um Materialien bereitzustellen und herunterzuladen. Sie verwendet das System nahezu täglich und hat sich am Vortag das letzte Mal eingeloggt, sodass diese Medienpraxis inkorporiert ist. Die Einführung der IWBs an der Schule hat die Praxis offenbar intensiviert, denn sie speichert in InfoChange auch die Folien, die sie für oder während der Arbeit am IWB produziert hat. Das Hinzufügen eines neuen Mediums in ihr Medienensemble trägt dazu bei, individuelle Medienpraxen zu intensivieren, da diese durch die Verknüpfung mit zusätzlichen Praxen höhere Sinnhaftigkeit und Relevanz bekommen. Die Lehrerin überprüft auch, welche Dateien ihre Kolleginnen und Kollegen in das SIS geladen haben, um diese ggf. herunterzuladen. Andere Möglichkeiten des SIS nutzt sie dagegen kaum. Das gilt z. B. für die „Ankündigungen“, ohne näher darauf einzugehen. Diese Kommunikate nimmt sie nur flüchtig wahr („flieg ich mal so drüber“). Sie erklärt diese Praxis damit, dass ihr das „irgendwie vom Format her nicht so sympathisch“ sei. Die Gestalt und/oder Bedeutung (Format) dieser Kommunikate besitzt für sie kein angenehmes Wesen. Im Gegensatz dazu lese sie lieber das „schlichte Mitteilungsbuch“ oder frage jemanden. Im Vergleich zu den Ankündigungen im SIS ist das Mitteilungsbuch einfach und bescheiden (schlicht). Im positiven Sinne ist dieses Medium auf das Nötigste und Wesentliche beschränkt und in keiner Weise aufwendig, ohne Zierrat oder überflüssiges Beiwerk. Vor diesem Hintergrund können die Ankündigungen aus den Orientierungen der Lehrerin heraus auch als schwierig bzw. eventuell umständlich in der Handhabung gelesen werden. Alternativ könne man auch jemanden fragen und so von Ankündigungen erfahren. Aufgrund dieser beiden Optionen besteht keine zwingende Notwendigkeit, die im SIS abgelegten Termine in Anspruch zu nehmen.
Ähnliches gilt für den „Terminkalender“, den Frau Zimball „auch“ nicht abonniert hat, da sie das „Gefühl“ habe, dass sie nicht „immer und überall erreichbar“ sein und „von Terminen belästigt werden“ will. Wieder verweist sie auf ihr konjunktives Wissen („das Gefühl habe“), wonach sie nicht ständig und nicht an jedem Ort erreichbar sein will. Sie verwehrt sich dagegen, immer und überall in kommunikative Praktiken verwickelt werden zu können. Gleichwohl ist diese Situation streng genommen der Kommunikation inhärent, da man der Lehrerin z. B. prinzipiell jederzeit ein Kommunikat übersenden kann, um sie zu ‚erreichen‘. Einen Zugang zum Internet vorausgesetzt, kann sie das im SIS abgelegte Kommunikat jedoch jederzeit aufrufen, anders als einen Brief, der ebenfalls einen Termin enthalten kann, aber nur zu einer bestimmten und erwartbaren Zeit zugestellt wird, und den man erst dann zur Kenntnis nehmen kann, wenn er im eigenen BrieThasten oder Postfach landet. Den etablierten Konventionen zufolge reicht es, einen Briefkasten einmal täglich auf den Empfang neuer Kommunikate hin zu überprüfen. In der Schule kann man das nur bei personeller Anwesenheit. Hat man das Schulgebäude verlassen, ist man mittels papierbasierter Kommunikate nicht mehr erreichbar und kann insofern den Empfang von Kommunikaten weitestgehend selbständig steuern und kontrollieren. Anders bei der E-Mail: Da man diese – den Besitz eines mobilen Endgeräts vorausgesetzt – nahezu überall und jederzeit empfangen kann, mag sich die Adressatin zum einen im Zweifelsfall genötigt sehen, möglichst schnell zu reagieren. Zum anderen besitzen die Termine eine störende Konnotation, die mit deren Sichtbarkeit i. S. der Wahrnehmbarkeit variiert. Stattdessen möchte sie kontrollieren, wann sie sich über bestimmte Dinge informiert. Verfügt sie über diese Art der Handlungskontrolle, ist es unproblematisch, Informationen im SIS nachzuschauen. Wenn sie stattdessen die Terminankündigungen als E-Mail-Benachrichtigungen abonniert, übe das auf sie einen ‚gewissen Druck‘ aus, d. h., sie fühlt sich durch die per E-Mail übermittelten Kommunikate einem Zwang und/ oder einer Belastung ausgesetzt. Daher nutzt sie das SIS primär, um sich mit Materialien zu versorgen oder sie für andere bereitzustellen.
Frau Kiefer arbeitet erst seit Kurzem an der Bergschule und ist u. a. dabei, sich in InfoChange ‚einzuarbeiten‘. Bei dem Vertrautmachen mit dem SIS handelt es sich um eine zweckgerichtete geistige Tätigkeit. Sie erforsche und erkunde die Nutzungsmöglichkeiten des Systems, welche Informationen dort abgelegt sind und wo man sie findet. Ihre Auseinandersetzung mit dem SIS ähnelt einem offenen Suchprozess. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass sie bislang keine systematische Unterstützung, z. B. auf Basis einer Einführung, erhalten hat, um sich mit dem SIS vertraut zu machen. Im Sinne der von ihr so genannten „Erkundungsphase“ ist das Ergebnis dieses Prozesses offen, sodass nicht gesagt ist, ob sie die Nutzung von InfoChange verstetigt.
Frau Lübbe nutzt das SIS als „Plattform“ in der Oberstufe, u. a. um „gezielt“ Arbeitsblätter für Lerngruppen bereitzustellen. Ihre Handlungspraxis ist stark zweckrational geprägt und bezieht die Schülerinnen und Schüler mit ein. Diese sollten sich dafür auch als User des SIS registrieren, dieser Aufforderung sind aber offenbar noch nicht alle nachgekommen. Des Weiteren nutzt sie InfoChange auch, um mit den Lernenden zu kommunizieren und erinnert sie beispielsweise an die Erledigung von Hausaufgaben oder gibt ihnen Hinweise zur Vorbereitung auf Prüfungen. Mit diesen Praxen habe sie auch auf Forderungen der Schülerinnen und Schüler reagiert, die sich „ein bisschen Kommunikation“ gewünscht hätten. Die gemeinsame Handlungspraxis verstärkt die auf digitalen Medien aufbauende kommunikative Praxis der Lehrerin, weil die Heranwachsenden bestimmte Formen der Kommunikation einfordern. Insofern kommen hier auch intergenerationelle Aspekte der Medienaneignung zum Tragen. An späterer Stelle thematisiert der Interviewer noch einmal die Nutzung des SIS und möchte wissen, ob die Frauen in InfoChange finden, wonach sie suchen (Gruppe Esche, Passage „Materialaustausch“).
Auf die Frage des Interviewers antwortet Frau Zimball, dass sie offenbar nach Durchlaufen einer einjährigen Praxisphase nunmehr die gewünschten Informationen oder Kommunikate findet. Wenn sie selber Kommunikate in InfoChange ablegt, kann sie auch „gleich rein [schreiben], wo es steht“, d. h., sie hinterlässt eine Nachricht, wo man die von ihr abgelegten Informationen findet. Gemeint ist damit wahrscheinlich ein Ort außerhalb des SIS, wie das interne Mitteilungsbuch ihres Jahrgangs, das für die anderen Lehrkräfte problemlos zugänglich ist, sodass sie, ausgestattet mit dieser Quellenangabe, besagte Dokumente auch in InfoChange finden könnten. Frau Lübbe fährt fort, dass die Mitglieder der Fachgruppe Englisch den Wunsch nach einer einheitlichen Benennung der in dem SIS abgelegten Materialien geäußert haben, um eine bessere Übersichtlichkeit für selbige zu schaffen. Frau Zimball ergänzt, dass man dabei sei, sodass es sich um einen laufenden Prozess handelt, in dessen Verlauf die Lehrkräfte versuchen, die vorhandenen Materialien zu sortieren, d. h. ihnen eine Ordnung zu geben, die letztlich auch die Auffindbarkeit verbessert. Bezogen auf das SIS weist Frau Lübbe auch darauf hin, dass „es“ auch ein „bisschen neu“ sei, d. h., man befindet sich noch in einer frühen Phase der Aneignung von InfoChange. Damit einhergeht, dass es gerade zu Beginn der Nutzung „echt ‘n Wust“ gewesen sei, sodass ein großes Durcheinander geherrscht hat bzw. eine ungeordnete Menge von Daten vorlag, was insbesondere für das Fach Englisch galt.
Frau Kirsten schließt mit ihrem Hinweis daran an, dass sie sich „immer noch so auf Erkundungstour“ befinde. Gemessen am Zeitpunkt ihres Eintritts in die Bergschule dauert das Kennenlernen des SIS bereits rund ein halbes Jahr. Ihre weiteren Ausführungen deuten darauf hin, dass auch sie Schwierigkeiten hat, gezielt bestimmte Kommunikate in dem SIS zu lokalisieren. So habe sie „‘ne Woche“ nach etwas gesucht und es schließlich nur aufgrund des Hinweises einer Kollegin auf den Speicherort gefunden. Diese habe genauso viel Zeit wie Frau Kirsten mit der Suche nach diesen Informationen zugebracht. Sie fasst ihre bisherigen Erfahrungen mit der Nutzung von InfoChange dahingehend zusammen, dass das System für jemanden, der oder die „neu an die Schule“ kommt, „relativ unübersichtlich“ sei, sodass es schwierig ist, sich im SIS adäquat zu orientieren. Frau Lübbe antwortet darauf, dass die Probleme nicht daraus resultierten, dass die Lehrkräfte neu an der Schule seien. Frau Kirsten unterbricht sie und wiederholt noch einmal den bereits erwähnten Aspekt der Unübersichtlichkeit. Auch Frau Zimball redet dazwischen und bemängelt, dass das „System […] blöde“ sei. Im übertragenen Sinne ist das SIS nicht intelligent und damit schlecht zu benutzen.
Frau Lübbe fährt fort, dass sie den Eindruck gehabt habe, dass über einen längeren Zeitraum hinweg „einfach wüst hochgeladen wurde“, d. h., die Lehrkräfte haben ihre Materialien in das SIS hineingeladen ohne Berücksichtigung der Speicherung und Wiederauffindbarkeit der Informationen. Wieder unterbricht sie Frau Zimball und kritisiert, dass InfoChange eine „schlechte Plattform“ sei, sodass das SIS von minderwertiger Qualität ist und ihren Ansprüchen an ein solches System nicht genügt. Frau Kirsten zieht im gleichen Kontext die Redewendung von „Kraut und Rüben“ heran und spricht damit noch einmal die fehlende bzw. ungenügende Ordnung der in InfoChange abgelegten Informationen an. Dann weist sie darauf hin, dass bisher scheinbar nur darauf geachtet wurde, überhaupt Daten in das SIS hineinzuladen („Hauptsache irgendwie drin“). Frau Lübbe bestätigt diese Annahme mit dem Hinweis, dass Daten „irgendwo hin“ geladen würden. Es mangelt demnach an einer erkennbaren Systematik, bzw. ist diese zumindest nicht etabliert und bekannt, sodass alle Benutzerinnen oder Benutzer das SIS in gleicher Weise nutzen würden. Das hat zur Folge, dass man, selbst wenn man selber etwas hochgeladen hat, diese Kommunikate u. U. nicht wiederfindet, wenn man danach sucht.
Frau Zimball gibt ergänzend zu bedenken, dass InfoChange auch nicht besonders leicht zu bedienen sei. Zu den genannten Schwierigkeiten der Ablage und Wiederauffindbarkeit von Informationen treten generelle Usability-Defizite des Systems. Frau Lübbe verifiziert diese Kritik. Frau Zimball fährt fort, dass InfoChange keine Plattform sei, da sehr viel Zeit vergehe, bis man sich in ausreichender Weise mit den Aspekten „Kategorie“, „Schlagwort“ und „Verlinkung mit anderen“ befasst habe. Aus dem Kontext ist zu schließen, dass sie die Auswahl einer oder mehrerer Kategorien und Schlagwörter meint, die erforderlich sind, um Dokumente in InfoChange so abzulegen, dass sie einfach wieder aufzufinden sind. Die angezeigte Zeitspanne von fünf Minuten könnte sich auf die Bearbeitung eines einzelnen Dokuments beziehen. Auf jeden Fall ist sie zu lang. Aufgrund der verschiedenen Mängel spricht die Lehrerin dem SIS seine systemtechnische Zugehörigkeit ab („ist auch keine Plattform“).
Frau Lübbe verifiziert die Kritik von Frau Zimball kommunikativ und weitet sie dahingehend aus, dass „teilweise“ in dem SIS auch „kaputte Dokumente“ lägen, die man auf dem eigenen Computer nicht öffnen kann. Selbst wenn man die gesuchten Informationen gefunden hat, ist nicht auszuschließen, dass man sie nicht weiterverwenden kann. Man könnte dieses Problem lösen, wenn man alle Materialien im SIS in einem einheitlichen Dateiformat (PDF-Dokument) zur Verfügung stellen würde. Allerdings könnte man dann z. B. Unterrichtsmaterialien nicht mehr bearbeiten, was deren Nutzen erheblich schmälern würde. Frau Zimball verifiziert das. Frau Lübbe konkludiert die geäußerte Kritik an InfoChange dahingehend, dass das System „‘n Haufen Nachteile“ habe, d. h. die Nutzung wird von vielen Umständen begleitet, die die Praxis beeinträchtigen. Trotz der erheblichen Defizite des vorhandenen Systems ist Frau Zimball aber generell vom großen Nutzen eines gut funktionierenden SIS überzeugt und die Praxis damit für sie von hoher (berufs-)biografischer Relevanz. Diese ist so groß, dass sie sogar selbständig nach einer geeigneten Alternativlösung sucht (Gruppe Esche, Passage „Materialaustausch“).
In England hatte sie demnach Gelegenheit, ein System in Augenschein zu nehmen, dass sie „wesentlich besser“ findet als InfoChange. Es handelt sich um ein Produkt, für dessen Nutzung man selbstverständlich („natürlich“) bezahlen muss, während die Nutzung von InfoChange für die A-Städter Schulen unentgeltlich sei. Das Adverb „natürlich“ signalisiert, dass eine kommerzielle IT-Lösung in der Regel die bessere Wahl für die unterschiedlichen Bedürfnisse der schulischen Kommunikation ist und z. B. im Gegenzug für die kostenpflichtige Leistung positive Rationalisierungseffekte ermöglicht. Besagtes SIS könne z. B. „automatisch“ sortieren, d. h. Dinge nach ihrer Zusammengehörigkeit ordnen. Das sei äußerst zweckdienlich („praktisch“), was von Frau Kirsten bestätigt wird. Selbstverständlich müsse man zuvor die Kriterien festlegen, nach denen Informationen in dem SIS sortiert werden, dieser Vorgang sei aber einmalig, sodass danach ein umfangreicher Rationalisierungsvorteil erzielt werden kann. Frau Zimball weist noch ein zweites Mal auf die erhebliche Zweckmäßigkeit dieser Funktionalität hin, die somit von zentraler (berufs-)biografischer Relevanz für sie ist. Auf Nachfrage nennt die Lehrerin den Hersteller des Systems und fährt fort, einzelne Funktionalitäten zu exemplifizieren (Gruppe Esche, Passage „Materialaustausch“).
Die Lehrerin erklärt, wie einzelne Dokumente durch das Hinzufügen eines Buchstabens in bestimmte Bereiche des SIS sortiert werden. Wie schon zuvor betont sie abermals den sehr viel größeren Rationalisierungseffekt gegenüber der Arbeit mit InfoChange. Die Nutzung des englischen SIS beschreibt sie anhand einer sehr physischen Metapher. Demnach gibt es in dem System „kleine […] virtuelle Schachteln“, deren Deckel man abnehmen und in die hineinschauen kann. Indem die traditionelle und bekannte Analogie des Sortierens von Dingen in Behältnisse auf die Nutzung des SIS übertragen wurde, fällt die Nutzung des Systems besonders leicht, da die Grundstruktur der physisch konnotierten Praxis adaptiert wird. Erleichternd kommt hinzu, dass in den jeweiligen Behältnissen nur Kommunikate abgelegt werden, die einen engen gemeinsamen thematischen Bezug aufweisen. Dieser Aspekt trägt ebenfalls zum hohen Rationalisierungspotenzial des in Augenschein genommenen Systems bei.
Die Ambivalenz der Medienpraxis am Beispiel E-Mail
Alle drei Lehrerinnen nutzen die digitalen Medien intensiv. Daneben sind für sie aber auch die traditionellen Medien nach wie vor von hoher (berufs-)biografischer Relevanz, wie der folgende Ausschnitt aus der Passsage „Postfach“ illustriert (Gruppe Esche, Passage „Postfach“).
Nachdem Frau Kiefer erzählt hat, wie sie Karteikarten und Papier im Unterricht einsetzt, möchte der Interviewer wissen, welche Rolle diese Medien für die Kommunikation der Lehrerinnen untereinander spielen. Frau Zimball beginnt die Fragestellung mit dem Hinweis zu elaborieren, dass sie das „nach wie vor unglaublich wichtig“ finde, d. h., der Einsatz papierbasierter Medien ist von zentralster biografischer Relevanz für sie. Ihre beiden Kolleginnen verifizieren diese Feststellung. Die herausgestellte Bedeutung hängt damit zusammen, dass Frau Zimball nicht bereit ist, sich dem Willen oder der Vorstellung zu fügen („unterwerfen“), permanent („Tag und Nacht“) per E-Mail erreichbar zu sein. Da die Lehrkräfte nicht dienstlich dazu verpflichtet werden können, E-Mails in einem bestimmten Turnus zu rezipieren, handelt es sich insofern um eine implizite Erwartung. Das heißt aber nicht, dass sie das Medium generell ablehnt, einmal täglich überprüft sie den Empfang von an sie adressierten E-Mails. Mit dieser Praxis zählt sie sich auch zu einer ausgewiesenen Gruppe von Personen, die offenbar ähnlich handeln. Ansatzweise wird hier die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Organisationsmilieu innerhalb der Schule erkennbar, das durch einen bestimmten Umgang mit einzelnen Medien charakterisiert ist. Mit der Überbetonung des Partikels „nur“ deutet sie außerdem an, dass diese Handlungspraxis sich von der E-Mail-Nutzung anderer Lehrkräfte deutlich unterscheidet und insofern einen mindestens erheblichen Kontrast bildet. Denn diese Lehrkräfte würden ihre E-Mails nahezu stündlich überprüfen. Frau Zimball lehnt nicht nur ab, ihre E-Mails häufiger als einmal täglich einzusehen, sie fordert auch eindringlich („will einfach auch nicht“), dass man ihr nicht noch am späteren Abend entsprechende Nachrichten sendet. Wenn sie ihre E-Mails einmal am Tag überprüft, ist es faktisch egal, wann diese gesendet werden, da sie dieser erst gewahr wird, wenn sie ihr E-Mail-Postfach einsieht. Problematisch könnte die Praxis werden, wenn sie ihr Postfach am späteren Abend überprüft und es dabei eventuell zu einer Vermischung von privater und dienstlicher Kommunikation kommt. Im Prinzip wiederholt sich hier die bereits zu Anfang von ihr artikulierte Orientierung am Wunsch nach der größtmöglichen Kontrolle über die eigene Kommunikation (s. o.). Es kann auch passieren, dass sie in ihrem Postfach eine „Praline“ vorfindet, die ihr eine Kollegin als Dank dafür hat zukommen lassen, dass sie ihr sehr viel „Material“ zur Verfügung gestellt hat. Über das Medium lassen sich nicht nur Papiere, sondern auch andere Artefakte geringer Größe zwischen den Lehrkräften austauschen. Ein solches Artefakt als Träger einer Danksagung, und i. d. S. auch ein Kommunikat, kann die Empfängerin in Hochstimmung versetzen („freu ich mich drüber“). Es könne aber auch sein, dass sie in ihrem Postfach einen ‚netten Zettel‘ findet, d. h. ein hübsches und ansprechendes Kommunikat.
Frau Zimball konkludiert die beiden Beispiele damit, dass sie die beschriebenen Formen der Kommunikation „angenehmer“ finde, als wenn sie selbige ausschließlich per E-Mail realisieren würde. Denn dann würde sie etwas vermissen („fehlt mir was“). Im Gegensatz zur Kommunikation per E-Mail erweist sich die Kommunikation über das Postfach als wohltuender und befriedigender, sodass hier auch emotionale Aspekte zum Tragen kommen, die von hoher biografischer Relevanz für die Lehrerin sind. Die Stofflichkeit der Kommunikate hat einen hohen Anteil an der qualitativen Beurteilung ihrer Kommunikation. Dieser Aspekt verweist auch auf die hohe biografische Relevanz der materiellen Anteile der Kommunikation. Sie fährt fort, dass „das Digitale […] zwar praktisch“ sei, d. h., diese Form der Kommunikation ist zweckdienlich, es fehle ihr aber das „Analog-Menschliche“, das sich u. a. im gelegentlichen Erhalt eines ‚netten kleine Zettel‘ im Postfach manifestiert. Das ‚Analoge‘ oder die Materialität der Kommunikation i. S. ihrer körperlichen Erfahrbarkeit konstituiert hier einen positiven Gegenhorizont zum digitalen Äquivalent und verweist auf die Interaktion, die ohne digitale Medien auskommt und i. d. S. originär menschlich ist. Zumindest indirekt angesprochen ist hier
auch die Frage nach der Authentizität der Kommunikation, die u. a. an die Stofflichkeit der Kommunikate als wichtigem Bestandteil der Kommunikation gebunden ist.
Frau Lübbe fährt fort, dass man die papierbasierten Kommunikate auch „besser aufhängen“ könne. Sie bemüht damit die erhöhte Zweckrationalität der Verwendung von Papier gegenüber dem digitalen Kommunikat. Das gilt insbesondere für solche, die sie regelmäßig benötigt, wie z. B. bestimmte Terminübersichten. Sie erhält diese Kommunikate in der Regel auch in digitaler Form, überführt sie aber durch Ausdrucken in die analoge Form und kann dann jederzeit darauf zugreifen, ohne erst den Computer zu starten. Letzteres ist für sie völlig unakzeptabel, sodass es keine Alternative zur Nutzung bestimmter Kommunikate in Papierform gibt („absolut notwendig“). Andere Kommunikate wie z. B. Protokolle erhält sich auch ohne eigenes Zutun in analoger und digitaler Form. Das empfindet sie als latent „überflüssig“, ohne dass klar wird, welche Form des Kommunikats sie vorzieht. Frau Zimball verifiziert diese Kritik. Frau Lübbe fährt fort, die hohe Relevanz von papierbasierten Kommunikaten für die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern zu beschreiben (z.B. Hefte, Strafarbeiten und Arbeitsblätter), die auch über ihr und ein Postfach für die Lernenden ausgetauscht werden. Wenig später thematisiert Frau Zimball mit der Verlegung von Netzwerkkabeln in der Schule einen weiteren Aspekt der Medienintegration in der Bergschule (Gruppe Esche, Passage „Postfach“).
Der Erzählung von Frau Zimball zufolge werden „grade alle irgendwie vernetzt“, sodass man zukünftig „theoretisch“ in jedem Klassenraum „online […] gehen“ könne. Offensichtlich werden die Klassenräume sukzessive mit Netzzugängen ausgestattet, die u. a. die Internetnutzung ermöglichen. Im Fokus ihrer Orientierung auf die Vernetzung stehen aber nicht die Räume, sondern die Mitglieder des Kollegiums („alle“), die in einer nicht näher bestimmten Weise („irgendwie“) miteinander verbunden („vernetzt“) werden. Gedankenexperimentell („theoretisch“) könne man dann auch im Klassenraum online gehen, um z. B. schnell jemandem mitzuteilen, wann und wo man sich treffe. Diese Nachricht könnte sie z. B. an Frau Lübbe adressieren, die möglicherweise im Nachbarraum sitze. Dem Wortsinn nach begrüßt sie diese Möglichkeit („ganz toll“), ihre Zustimmung scheint aber ironischer Natur zu sein, sodass diese Handlungspraxis für sie eher nicht in Frage käme. Frau Zimballs anschließende Differenzierung zeigt in die gleiche Richtung. Sie fände eine solche Praxis seltsam („strange“), sodass sie keine Übereinstimmungen mit ihren eigenen Konjunktionen aufweist. In die gleiche Richtung zeigt der Einwurf von Frau Kiefer, die diese Form der Kommunikation für „übertrieben“, d. h. übersteigert, hält. Das hypothetische Beispiel dient Frau Zimball als Aufhänger für die Kritik einer Entwicklung („geht das auch in eine Richtung“) der schulorganisatorischen Kommunikation, die ihr latentes Misstrauen hervorruft und ihr eigenartig und seltsam erscheint. Das unterstreicht noch einmal die fehlende biografische Verankerung weiter Teile der digitalisierten schulorganisatorischen Kommunikation innerhalb ihres Orientierungsrahmens. Laut Frau Lübbe sei das „das Problem“, sodass hier Schwierigkeiten existieren, für die noch geeignete Umgangsweisen zu entwickeln sind. Es mangelt insofern sowohl an den informellen Regeln eines Organisationsmilieus als auch an milieugeprägten praktischen Umgangsweisen mit diesem Phänomen. In Vorwegnahme einer Entscheidung verlassen sich die Lehrkräfte zunächst auf die etablierten und bewährten kommunikativen Praktiken. Frau Zimball gibt zu bedenken, dass sie außerdem auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen „sprechen“ möchte. Wieder stimmt Frau Lübbe zu und weist abermals darauf hin, dass das das Problem sei. Die von ihr angesprochene Schwierigkeit entfaltet sich entlang der permanenten impliziten Befürchtung eines Verlustes der Relevanz der und Möglichkeiten zur direkten interpersonalen Kommunikation. Frau Kiefer ergänzt, dass man auch „viel mehr“ austausche, „wenn man wirklich noch mal miteinander spricht“. Die Face-to-Face-Kommunikation besitzt demnach gegenüber der computervermittelten Kommunikation eine höhere Qualität, die auf deren wesentlich größerem Maß an Reziprozität basiert. Diese ist auch Voraussetzung dafür, dass Informationen in einer bestimmten Weise ausgetauscht und wahrscheinlich im Zuge des direkten Dialoges in den eigenen Orientierungsrahmen eingearbeitet werden.
Obwohl Frau Kiefer die Face-to-Face-Kommunikation der Kommunikation per E-Mail vorzieht, bekommt sie selbstverständlich auch E-Mails und liest sie. In ihrer vorherigen Schule habe sie täglich ihre E-Mails abgerufen. Mit ihrem Wechsel an die Bergschule hat sich diese Praxis intensiviert. Jetzt schaut sie auch, bevor sie in die Schule fährt und vor dem zubettgehen nach ihren E-Mails. Die beruflich orientierte E-Mail-Kommunikation hat mit dem Wechsel der Schule einen deutlich höheren Stellenwert im Rahmen der Alltagskommunikation der Pädagogin erhalten. Diese Kommunikation steht am Anfang und am Ende ihres Arbeitstages, der nicht mehr erst in der Schule, sondern schon in ihrer Privatsphäre beginnt und dort auch endet. Insofern kommt es hier auch zu einer weiteren Intensivierung der für die Arbeit von Lehrkräften typischen Vermischung von Arbeits- und Privatsphäre. Hier wird nunmehr auch deutlich, dass es diese Form der Sphärendiffusion ist, gegen die sich Frau Zimball wehrt und die sie in engen Grenzen zu kontrollieren versucht (s. o.).
Der Grund für die intensivierte Praxis hängt mit der veränderten kommunikativen Praxis in ihrem neuen Kollegium zusammen. Denn „viele“ ihrer Kolleginnen und Kollegen schrieben „wahnsinnig gerne nachts E-Mails“, sodass es Sinn macht, ihren E-Mail-Account früh morgens zu überprüfen, um in der Nacht an sie gesendete E-Mails lesen zu können. Warum die Lehrkräfte selbst nachts dienstliche E-Mails schreiben, kann sich Frau Kirsten nicht erklären, was aber auch nicht zwingend erforderlich ist, denn sie akzeptiert diese Praxis und passt sich ihr insofern an, indem sie nun auch am Morgen ihren E-Mail-Empfang überprüft. Der Hinweis von Frau Lübbe, dass sie auch nachts noch E-Mails schreibe, findet in der Gruppe keine weitere Beachtung, zeigt aber, dass die angesprochene Flexibilisierung der beruflichen Kommunikation nicht mit einer uneingeschränkten Befürwortung der damit assoziierten Medienpraxen einhergehen muss. Die beruflich relevante kommunikative Praxis zumindest von Teilen des Kollegiums der Bergschule ist stark flexibilisiert und in Teilen nicht mehr an bestimmte Zeiten gebunden.
Abschließend weist Frau Kiefer noch einmal darauf hin, dass diese Art der Kommunikation die spontane direkte interpersonale Kommunikation nicht ersetzen könne, da man so „viel mehr Kleininfos“ austauschen könne. Abermals gibt der Umfang der auf diese Weise kommunizierbaren Informationen den Ausschlag für die Medienwahl. Die Begründung ist, ähnlich wie bei Frau Lübbe, zweckrational motiviert: Man kann bei gleichem Zeitaufwand wie bei der computervermittelten Kommunikation in der Face-to-Face-Situation mehr Informationen einer bestimmten Qualität austauschen. Die rasche Interaktion und die unmittelbare Präsenz der Kommunizierenden hat einen wichtigen Anteil an dieser kommunikativen Qualitätsdimension.
Frau Zimball fährt fort, dass sie auch nicht ihre ganze Kommunikation schriftlich abwickeln will. Über bestimmte Themen spreche sie stattdessen ausschließlich im Modus der interpersonalen direkten Kommunikation mit nur einer weiteren Person. Dann lässt sich dem Kommentar von Frau Lübbe zufolge das zu behandelnde Thema auch in dieser Situation abschließen. Das heißt, es bedarf keiner Anschlusskommunikation mehr, sodass abermals positive Rationalisierungseffekte der Face-to-Face-Kommunikation hervortreten. Außerdem will Frau Zimball auch nicht, dass diese Kommunikation schriftlich dokumentiert wird, wie es z. B. bei der Nutzung von E-Mail der Fall ist. Denn in der Schule gebe es gelegentlich kommunikative Anlässe, deren Gegenstände (z. B. das Gespräch über eine Schülerin) äußerst verschwiegen („sehr diskret“) zu behandeln seien. Dazu kommt, dass die Kommunikation per E-Mail immer auch ein Dokument hervorbringt, das „in die falschen Hände“ geraten und damit „viel Schaden anrichten“ könne. Damit besteht das Risiko der missbräuchlichen Verwendung des im Zuge der Kommunikation per E-Mail anfallenden Kommunikats mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen. Auch aus diesem Grund hat die Face-to-Face-Kommunikation für Frau Zimball eine herausragende Bedeutung, hier weil sie ein weitaus geringeres Verbindlichkeitsniveau aufweist als die computervermittelte Kommunikation. Angesprochen sind damit auch die generellen Grenzen der Schriftlichkeit, welche die Medienwahl ebenfalls beeinflussen. Auch dieser Aspekt trägt zur hohen Ambivalenz bei, die dem Handeln mit den verschiedenen Medien in der Schule inhärent zu sein scheint, wie auch die folgende Sequenz anschaulich verdeutlicht (Gruppe Esche, Passage „E-Mail“).
Auch im Jahrgang von Frau Zimball wird E-Mail für die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Jahrgangs genutzt. Mit Hilfe eines Verteilers lassen sich z. B. Mails an alle Mitglieder verschicken. Erst vor wenigen Tagen hat eine Kollegin oder ein Kollege über diesen Verteiler das Protokoll einer Sitzung an die Lehrkräfte verschickt, das er offensichtlich über Nacht erstellt hat. Laut Frau Zimball sei das „wieder so’n Nachtschreiber“ gewesen, und sie bezieht sich damit auf die an früherer Stelle der Gruppendiskussion bereits thematisierte Gruppe von Lehrkräften, die auch noch sehr spät E-Mails an ihre Kolleginnen und Kollegen schreiben (s. o.). Das sei selbstverständlich („natürlich“) großartig, da man gleich am nächsten Morgen das Protokoll vorliegen habe. Zeit, es zu lesen, hätte sie aber erst am Tag darauf gehabt. Damit ist es zwar positiv, das Kommunikat schnell zu erhalten, die Lehrerin kann daraus aber keinen Nutzen ziehen, da sie erst wesentlich später Zeit findet, es zu rezipieren.
Auf Nachfrage berichtet Frau Lübbe, dass in ihrem Jahrgang „immer zwei Klassen […] eng vernetzt“ seien, d. h., zwischen diesen besteht eine besonders intensive Verbindung. Dort ist es Herr Meier, „der ganz rege E-Mails schreibt“. Wahrscheinlich gehört er zu der Klasse, mit der Frau Lübbe eng zusammenarbeitet. Sie frage sich aber regelmäßig („immer“), ob es nicht ausreichen würde, die E-Mails am nächsten Tag zu versenden. Damit spielt auch der Aspekt der Dringlichkeit der Kommunikation eine Rolle bei der Beurteilung selbiger. Frau Zimball stimmt ihr zu. Besagter Lehrer schicke z. B. auch viele Dokumente (z. B. Elternbriefe), die er vorbereitet hat, „schon mal rum“. Frau Lübbe sieht keine zwingende Notwendigkeit für diese kurzfristige Handlungspraxis, da man die versendeten Kommunikate auch am darauffolgenden Tag in Augenschein nehmen könne. Sie sei sich auch nicht „immer sicher“, inwieweit es erforderlich ist, in der beschriebenen Weise zu kommunizieren. Insofern fehlt es hier auch an formalen oder informellen Regeln, die Handlungssicherheit darüber schaffen, wie E-Mail in den verschiedenen kommunikativen Situationen in der Schule einzusetzen ist. Die Lehrerin fragt sich außerdem, ob man nicht z. B. einfach bis zum nächsten Tag warten könne, um dann mit der betreffenden Person zu sprechen. Auch hier existiert keine formale Regel für die Kommunikation. Die Entscheidung für ein bestimmtes Medium wurde von dem Kollegen getroffen, wird aber von der Lehrerin infrage gestellt, und die Bewährung der Praxis als Voraussetzung zur Entwicklung einer informellen Regel ist nicht gesichert.
Die beiden anderen Lehrerinnen gehen nicht weiter auf die aufgeworfene Frage ein, die somit für sie keine besondere Relevanz besitzt. Frau Zimball fährt fort, dass sie einmal die Woche nicht an der Schule sei, und stattdessen in der „Fortbildung tätig“ sei. Am Tag davor nutzt sie E-Mail mit Vorliebe („gern“). Das Medium erweist sich in dieser Situation als geeignet, um eine kommunikative Absicht zu realisieren, die sie ansonsten aufschieben müsse und die Nutzung ist i. d. S. zweckmäßig. Es handelt sich aber letztlich um eine wohldosierte Ausnahme, denn „ansonsten […] sollte die E-Mail nicht den persönlichen Kontakt und den netten Schwatz auch ersetzen“. Erneut steht die interpersonale direkte Kommunikation im Fokus ihrer biografischen Orientierungen. Dazu kommt mit dem „netten Schwatz“ noch eine qualitative Dimension der Kommunikation, nämlich die des freundlichen, wortreichen und belanglosen Redens. Diese Form der Kommunikation kommt auch ohne ein zweckrationales Motiv aus und bildet insofern eine Art Kitt, der die persönlichen Beziehungen zwischen den Lehrkräften stärkt. Frau Lübbe ergänzt, dass die Kommunikation per E-Mail die direkte interpersonale Kommunikation zweifellos („sowieso“) nicht ersetzen „kann“ und exemplifiziert das. Erst am Vortag habe sie erneut („wieder“) Pläne für die Organisation der bevorstehenden Projektwoche per E-Mail erhalten. Sie hätte diese Dokumente schriftlich ergänzen können. Unabhängig davon muss sie sich mit den beteiligten Kolleginnen und Kollegen sowieso treffen, um über die Pläne zu reden und sie fertigzustellen. Das vorweggenommene Kommentieren hätte somit einen Mehraufwand verursacht. Sie benötigt die Pläne außerdem auch nicht für die Vorbereitung des ausstehenden Abstimmungsprozesses, es genügt ihr, diese während des Treffens einzusehen. Insofern erweist sich die Medienpraxis in diesem Kontext als sinn- und zwecklos und damit als bedeutungslos für die Lehrerin.
In anderen Kontexten ermöglicht der Einsatz von E-Mail im Gegensatz dazu eindeutige positive Rationalisierungseffekte für die Lehrerin. Das ist z. B. der Fall, wenn man die Vorlage eines Elternbriefs per E-Mail erhält und die Weitergabe an die Eltern nur noch autorisieren muss. Der positive Rationalisierungseffekt ist in diesem Fall aber nur sekundär an das Medium gebunden, sondern primär an die Handlungspraxis einer anderen Lehrkraft. Mit Hilfe des Mediums werden lediglich die Zirkulation des Elternbriefs und die Abstimmung darüber beschleunigt. Daher muss man laut Frau Lübbe von Fall zu Fall abwägen, ob man die digitalen Medien zur Realisierung einer bestimmten Handlungspraxis einsetzt. Dabei kommen mehrere Kriterien zum Tragen: Erstens die Frage nach der Notwendigkeit, wobei offenbleibt, welche Kriterien maßgeblich für die Bewertung der Praxis sind. Zweitens ist zu fragen, ob mit der Entscheidung für das Medium E-Mail positive Rationalisierungseffekte verbunden sind. In diesem Zusammenhang ist auch zu überprüfen, ob der Einsatz von E-Mail u. U. zu einer „doppelte[n] Beschäftigung mit ´ner Kleinigkeit“ führt. Damit geht es drittens um die Frage, ob der Einsatz des Mediums eine überflüssige Handlungspraxis hervorruft, da eine andere kommunikative Praktik sowieso erforderlich ist. Abermals wird deutlich, dass es beim Einsatz der digitalen Medien häufig noch an geeigneten Regeln fehlt, um die Praxen auf das Niveau selbstverständlicher organisationskultureller Praktiken zu heben.
Zusammenfassung
Die drei Lehrerinnen aus der Gruppe Esche nutzen unterschiedlichste Medien für die schulorganisatorische Kommunikation und weisen eine große Vertrautheit mit den digitalen Medien auf. Frau Zimball und Frau Lübbe nutzen z. B. das SIS der Schule regelmäßig, während Frau Kirsten sich noch mit dem System vertraut macht, da sie erst seit Kurzem an der Schule ist. Alle drei kritisieren einhellig erhebliche Defizite bei der Handhabung des Systems, die insbesondere die Zuordnung der abgelegten Kommunikate betrifft. Während Frau Lübbe InfoChange neben dem Austausch von Materialien vor allem für die Arbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern nutzt, tauscht Frau Zimball damit fast ausschließlich Unterrichtsmaterialien aus. Diese Praxis ist für sie von so hoher (berufs-)biografischer Relevanz, dass sie sogar selbständig nach alternativen Systemen sucht.
Andere Möglichkeiten des SIS nutzt sie kaum oder lehnt sie ab, da sie im Widerspruch zu zentralen Elementen ihrer (berufs-)biografischen Orientierungen stehen. Das sind zum einen der ausgeprägte Wunsch nach der möglichst weitgehenden Kontrolle über die eigene schulorganisatorische Kommunikation und zum anderen die zentrale Orientierung an der interpersonalen direkten Kommunikation. Diese ausgeprägte Vorliebe trägt mit dazu bei zu erklären, dass die Zunahme der computervermittelten Kommunikation nicht mit der Reduzierung der Face-to-Face-Kommunikation einhergeht, sondern immer mit einem Verlust gleichgesetzt wird. Das gilt besonders für Frau Zimball. Ihre Orientierung an der Face-to-Face-Kommunikation ist stark an deren Authentizität, Ursprünglichkeit sowie die Materialität der Praxis gebunden. Zusammen definieren diese Aspekte eine spezifische Qualitätsdimension der interpersonalen direkten und originär menschlichen Kommunikation und fundieren daran entlang einen maximalen Kontrast zur digitalen Kommunikation. Gerade an die Materialität der Praxis schließt die ungebrochen hohe (berufs-)biografische Relevanz papierbasierter Kommunikate für alle drei Lehrerinnen an. Hier ist jedoch insofern eine Differenzierung erforderlich, als dass im Zentrum der Orientierungen von Frau Lübbe vor allem das positive Rationalisierungspotenzial, einhergehend mit der Zweckmäßigkeit der verschiedenen Praktiken, steht, das den Ausschlag für die Wahl ihrer Handlungspraxis gibt. Auch für die anderen beiden Gruppenmitglieder ist die individuelle Kontrolle über die schulorganisatorische Kommunikation eine zentrale Herausforderung. Diese wird insbesondere durch die andauernde Digitalisierung dieser Kommunikation und der damit u. a. einhergehenden Entgrenzung von Raum und Zeit sowie der Tendenz zum Zwang, digitale Medien zu nutzen, zunehmend erschwert. Frau Kirstens Praxisveränderung illustriert das anschaulich. An ihrer alten Schule hat es genügt, zu Hause einmal täglich das eigene E-Mail Postfach auf den Eingang von Mails von Kolleginnen oder Kollegen hin zu überprüfen. Seit sie an der Bergschule arbeitet, schaut sie nicht nur am Abend, sondern auch vor der Arbeit nach ihren E-Mails, weil nicht wenige Lehrkräfte noch spät abends oder nachts solche Kommunikate verschicken. Insofern ist hier auch eine neue informelle Regel entstanden, um die veränderte Situation angemessen zu bewältigen. Dazu kommen technische Veränderungen (aktuell in Form der Vernetzung der Unterrichtsräume), die die Lehrerinnen eine weitere Intensivierung der digitalisierten schulorganisatorischen Kommunikation zu Lasten der Face-to-Face-Kommunikation befürchten lassen, die es ihnen irgendwann nicht mehr möglich machen, auf Grundlage der praktischen Lebensweisen der Milieus zu handeln, denen sie zugehören. Darüber hinaus mangelt es auch dieser Gruppe an z. B. formalen oder informellen Regeln, wenn es um die Frage geht, ob und wie die digitalen Medien in unterschiedlichen schulisch konnotierten kommunikativen Kontexten einzusetzen sind.
Mit freundlicher Genehmigung des VS Verlages.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-03677-5_3
Nutzungsbedingungen:
Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, bzw. nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt – es darf nicht für öffentliche und/oder kommerzielle Zwecke außerhalb der Lehre vervielfältigt, bzw. vertrieben oder aufgeführt werden. Kopien dieses Dokuments müssen immer mit allen Urheberrechtshinweisen und Quellenangaben versehen bleiben. Mit der Nutzung des Dokuments werden keine Eigentumsrechte übertragen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.